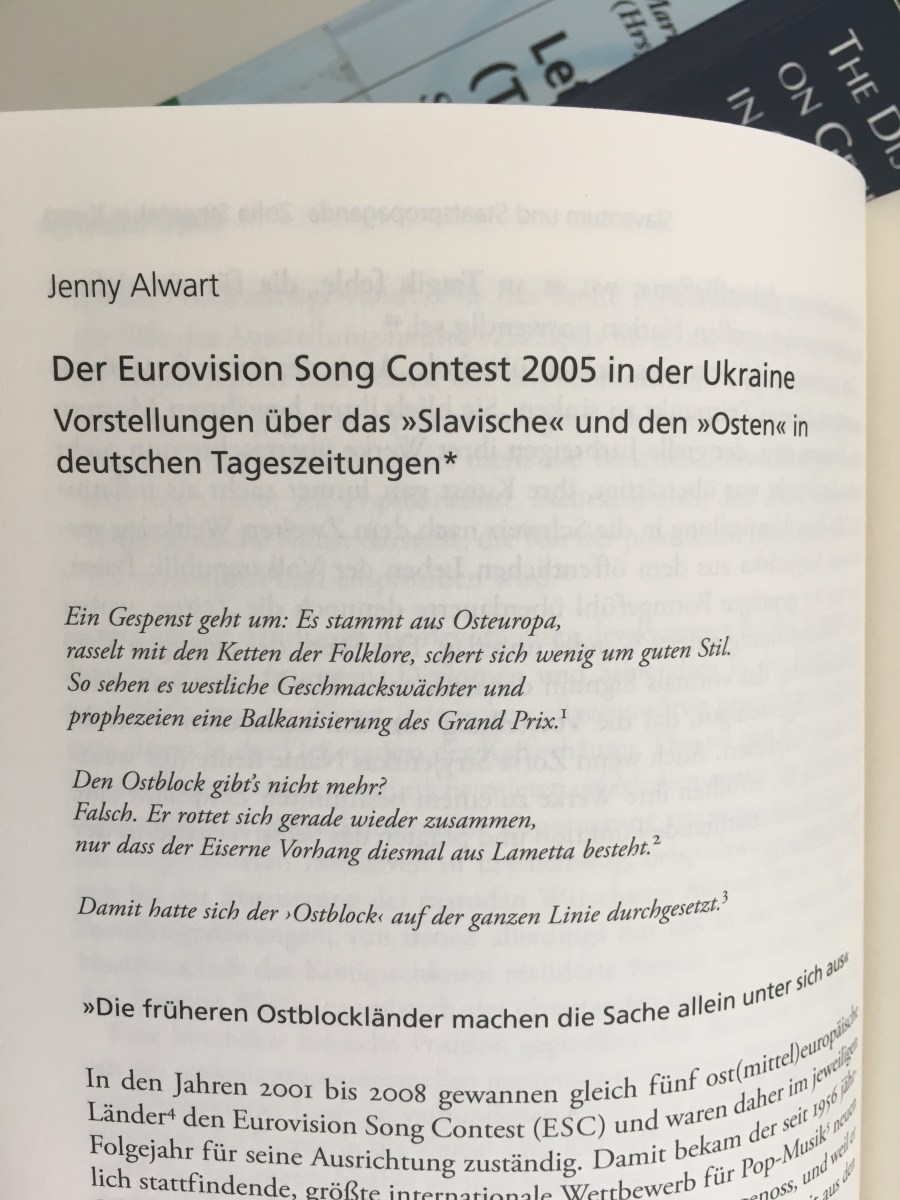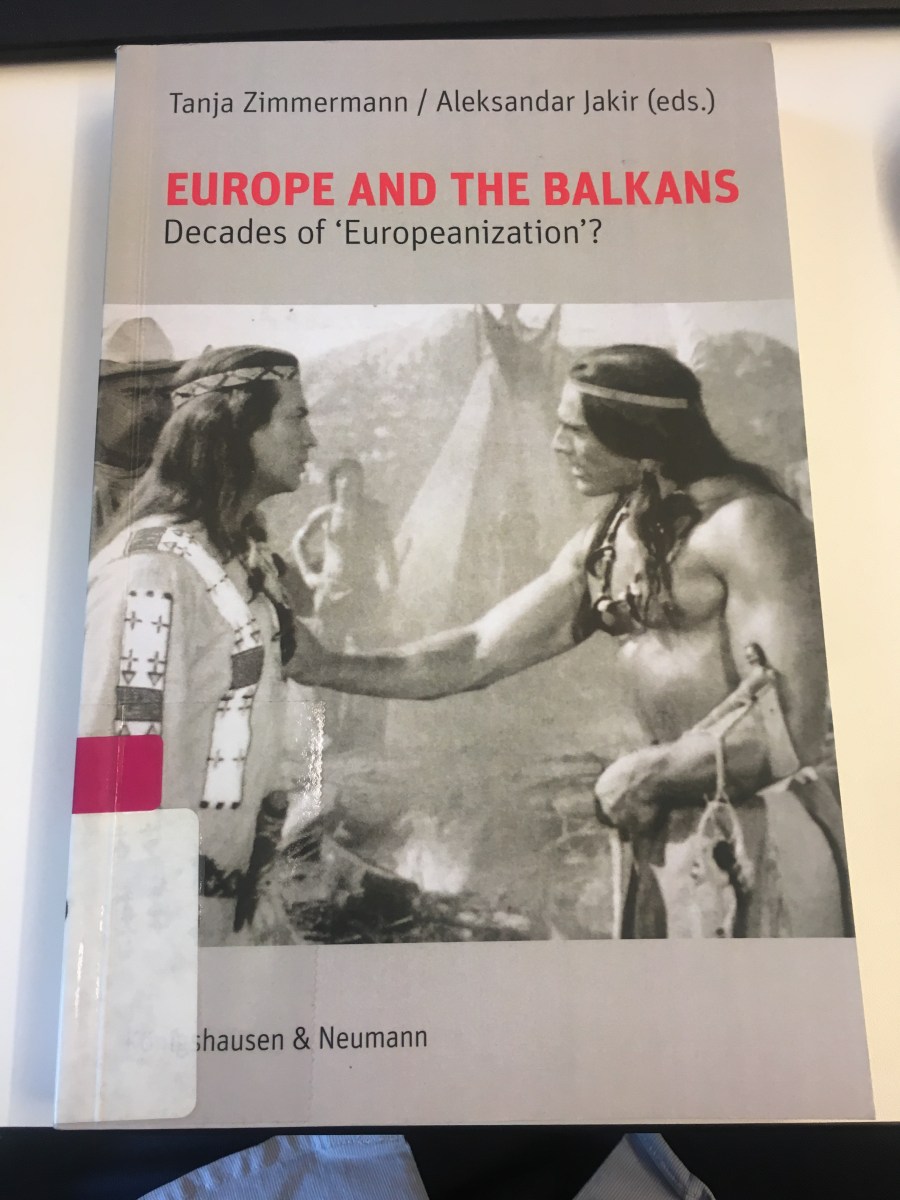Mit zum Schönsten am Beruf der Bibliothekarin gehört die Tatsache, dass man in einer Welt, die immer digitaler wird regelmäßig in die vertraute alte Zettelwirtschaft zurückwechseln darf.
Die brennende Frage, die den Nutzer und die Nutzerin (und in Folge auch die Bibliothekare) umtreibt lautet ja in den meisten Fällen „Wo ist das Buch?“. Früher kamen die Leute noch mit kleinen Zettelchen an den Schalter. Auf dem Zettelchen, das damals noch nicht post-it hieß, sah man eine Signatur, einen Einkaufszettel oder irgendetwas, das aussah wie eine EKG-Linie. Heute halten Nutzer uns in aller Regel ihre Smartphones unter die Nase, oder manchmal auch gleich den ganzen Laptop, sie fragen „Wo ist das?“ und deuten dabei auf den Bildschirm. An dieser Stelle wundere ich mich dann immer, wie zerkratzt ein Handybildschirm eigentlich sein kann, von dem man noch lesen können möchte, und höre regelmäßig: „Ich warte noch bis das neue Modell rauskommt, dann kaufe ich mir ein Neues..“
Ein neues Modell – Ordnung ist das halbe Leben
Die Bibliothek pflegt indessen unverdrossen ein System aus Stempeln, Etiketten, Laufzetteln und Lieferscheinen, das historisch gewachsen ist und technisch durchaus seine Berechtigung hat. Nichts ist sicherer als ein physischer Beweis, den man auch angreifen kann und „Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.“ (Faust). Ein weiterer Vorteil von analoger Verwaltung ist ihre Eigenschaft, dass man sie so schwer hacken kann.
Wie sehr das Analoge und das Digitale ineinandergreifen, bemerkt man aber spätestens dann, wenn man papierne Arbeitshilfen zu Dokumentations- oder Überprüfungszwecken „noch eben mal kurz abfotografiert“. Es passiert nicht selten, dass ich mit meinem Handy Fotos von Signaturen, Rechnungen oder irgendwelchen Verlagsprospekten mache, um dann am Computer nochmal zu schauen, was es damit für eine Bewandtnis hat. Manche Leute fotografieren auch die Einträge aus ihrem papiernen Stehkalender regelmäßig ab, sprechen aber nicht darüber. Die Lehrenden an Schulen und Unis machen übrigens etwas Ähnliches: Sie schreiben mit bunten Stiften auf ein Whiteboard (eine Art moderne Form der Tafel), und fotografieren das Ganze dann ab um es als grafisches Protokoll hochzuladen und für die Studierenden zur Verfügung zu stellen. Ziemlich Meta.
Hier in der Bibliothek erwerben und verwalten wir jedenfalls viele tausend Bücher und Medien, die alle in die richtige Schiene geführt werden müssen. Dabei geht es manchmal zu wie am Flughafen: Wenn irgendwo auf der Datenautobahn ein Unfall passiert, ist das eBook plötzlich gesperrt, und wenn ein Buch mit falschem Vermerk an einem Institut einlangt und die das dort nicht merken, dann verschwindet so eine ganze Ladung Bücher auch gerne mal ganz unbemerkt im System. Aus diesem Grund werden Laufzettel eingelegt, die mit dem Buch mitlaufen und nach einem ausgeklügelten Farb- und Namenscode bis zum Eintreffen am Zielstandort eingelegt bleiben. Man mag das altmodisch nennen, aber es funktioniert.
Die preußischen Instruktionen

Wenn man auf einer Party so richtig auftrumpfen will, erzählt man einfach von den Preußischen Instruktionen: Die Preußischen Instruktionen waren ein Bibliographier-System, das sich an der Informationshierarchie alter Karteikarten orientierte, im Grunde also eine Art Datenbanksprache. Es ist ein veraltetes Regelwerk, und mutet furchterregend umständlich an. Die Hauptregel, die jeder Bibliothekarsschüler im Lehrgang zumindest noch einmal erzählt bekommt: Als erstes Ordnungswort wird das erste von keinem anderen Wort grammatisch abhängige Substantiv genommen, das Substantivum regens.
zB: Des Meeres und der Liebe Wellen wäre dann zB einzuordnen unter Wellen, und so weiter.
Im Grunde machen Juristen ja etwas ganz Ähnliches: Sie subsumieren Sachverhalte unter Regeln, sie sagen: Aja, das gehört hier dazu.
Zettelkästen
Im Prinzip beschrieben die Preußischen Instruktionen nur eine Gebrauchsanweisung für ein alphabetisches Sortiersystem, mit dem man Zettelkästen bespielen konnte, so ähnlich wie heute Algorithmen und Programmiersprachen beschreiben, wie Informationen im Internet dargestellt, gefiltert und verarbeitet werden können.
Zettelkästen waren damals eine verbreitete Katalogform, auch wir haben noch ein paar von diesen Ungetümen im Fundus. Man munkelt sogar, dass eine Bibliothekarin vor dem Umzug ein paar alte Institutszettelkästen in ihren Privathaushalt überführt hat, um Wolle, Postkarten und ähnliche Kleinodien darin zu verwahren, doch das müssen wilde Gerüchte sein.
Analoge Entlehnsysteme – Ich lasse den Freund dir als Bürgen, ihn magst du, entrinn ich, erwürgen
Auch zum Entlehnen von Büchern gab es ein System, das auf Papier läuft: Wer ein Buch aus dem Regal entnahm, trug (bei vorhandenem Anstand und Ehrgefühl) den Titel und seinen Namen auf eine sogenannte Entlehnkarte ein. In Österreich sagen wir auch Buchreiter zu diesen Kartonscheibletten, während Deutschland den viel liebevolleren Begriff „Buchstellvertreter“ dafür geprägt hat. Man muss nicht an einer Uni arbeiten, um zu erkennen, dass dieses System von einer gewissen Moral abhängt, und daher fehleranfällig ist. Jedenfalls aber kann man an einem solchen Buchstellvertreter zumindest eine gewisse Zeitlang noch die Entlehnhistorie nachvollziehen, erstaunt lesen dass Prof. X zuletzt 1994 mit dem besagten Kommentar gearbeitet hat, und zu dem Schluss kommen, dass Prof. X mittlerweile seit über 10 Jahren emeritiert ist. Das traurige an Buchstellvertretern ist zwar, dass früher oder später nur noch der Stellvertreter da ist, aber niemals das Buch. Doch wenigstens hat man dann noch den Karton, um sich zu trösten, während elektronische Daten meistens einfach weg sind. Zumindest gibt einem dieses System ein Gefühl des Funktionierens und ein gewissens Vertrauen in die Weltordnung, bevor sich die Spur eines Buches im Dunkeln verliert..
Der Buchstellvertreter und die DSGVO
Solange Daten in lokalen Papiersystemen physisch vor Ort verzeichnet waren, hatte niemand schlaflose Nächte wegen ihrer Abrufbarkeit. Das stellt sich mit der in Kraft getretenen DSGVO und dem erhöhten Bewusstsein für Datenschutz in digitalen Welten freilich anders dar. Ob man auf einem Server oder in einer Cloud Dutzende von verknüpften Nutzer- und Entlehndaten hosten und bearbeiten darf, und unter welchen Bedingungen, ist zB Gegenstand zahlreicher juristischer Diskussionen, die im Moment nicht nur die Unis beschäftigen. Auch die Frage, ob auf Mitarbeiter entlehnte Bücher in einem weltweit abrufbaren Webkatalog mit Name gelistet werden dürfen, steht dabei immer wieder im Raum, und sie wird durchaus unterschiedlich beantwortet.
Am anderen Ende der Leitung
Um zum Handy am Anfang zurückzukommen: Eine Freundin von mir schrieb einst eine Arbeit über die Anfänge des Telefons („Das Pferd frisst keinen Gurkensalat!“, Sie wissen schon). Darin wurde auch verhandelt, dass die ersten Benutzer des Telefons noch keine Erfahrung mit dem Fernsprechen hatten, sie mussten erst eine Kultur der Unterhaltung mit diesem Apparat entwickeln. Da man aufgrund der Übertragungsschwäche oft keinen guten Ton hatte, konnte man nie so sicher sein, wann und ob das Gegenüber das Telefongespräch beenden wollte. Daher kam man überein, dass als Signal des Gesprächsendes laut das Wort „Schluss!“ in den Hörer zu rufen sei.
In der Nationalbibliothek wiederum wurde vor nicht allzulanger Zeit noch vom Saaldienst durchgegangen und „Leseschluss!“ gerufen, um die Nutzer abends zum Gehen aufzufordern. Seit neuestem wird angeblich nur noch ein Lied abgespielt, was natürlich nicht halb so cool ist..
Ich werde an dieser Stelle nun auch mit gutem Beispiel vorangehen (ins Wochenende), ich rufe ein herzliches Schluss! in die Runde, und begrüße Sie nächste Woche wieder an dieser Stelle, wenn es heißt:
Das ANALOGE und das DIGITALE
–SCHLUSS!–