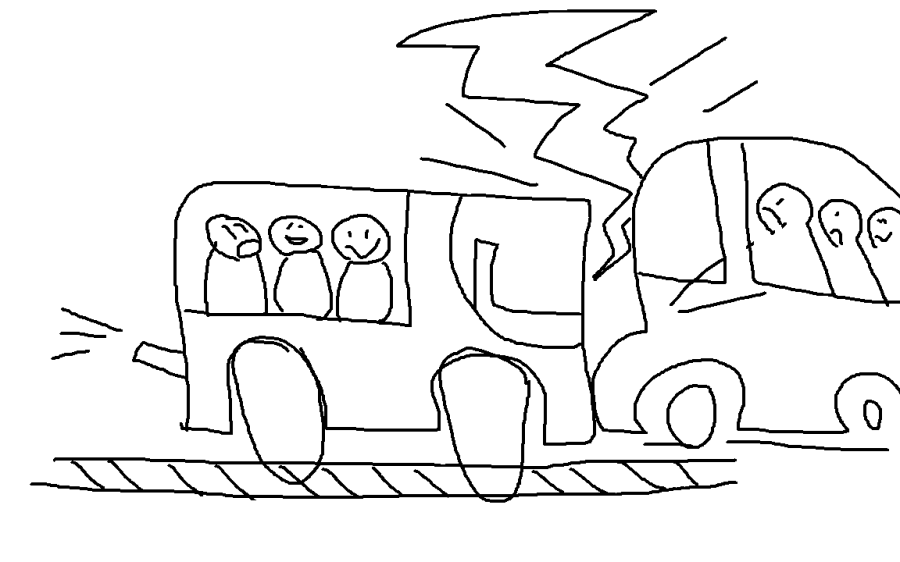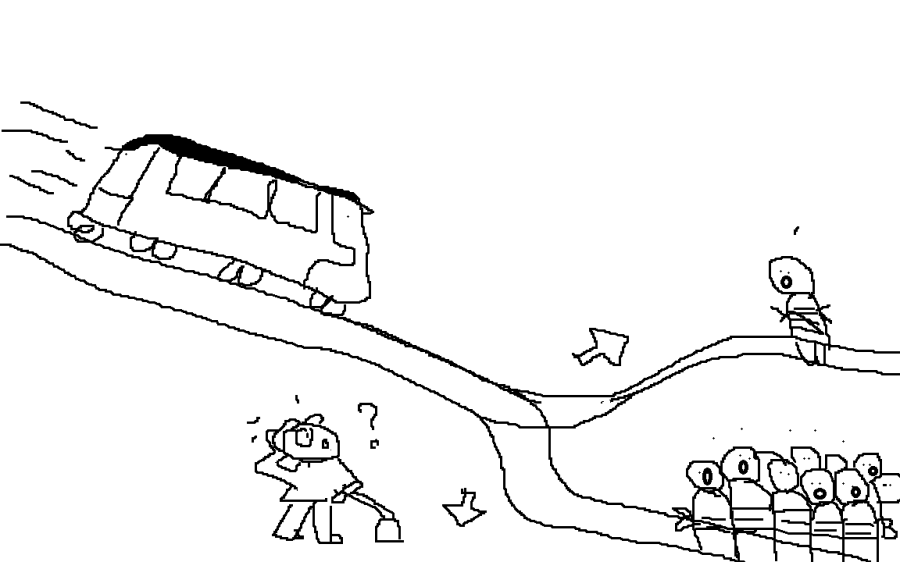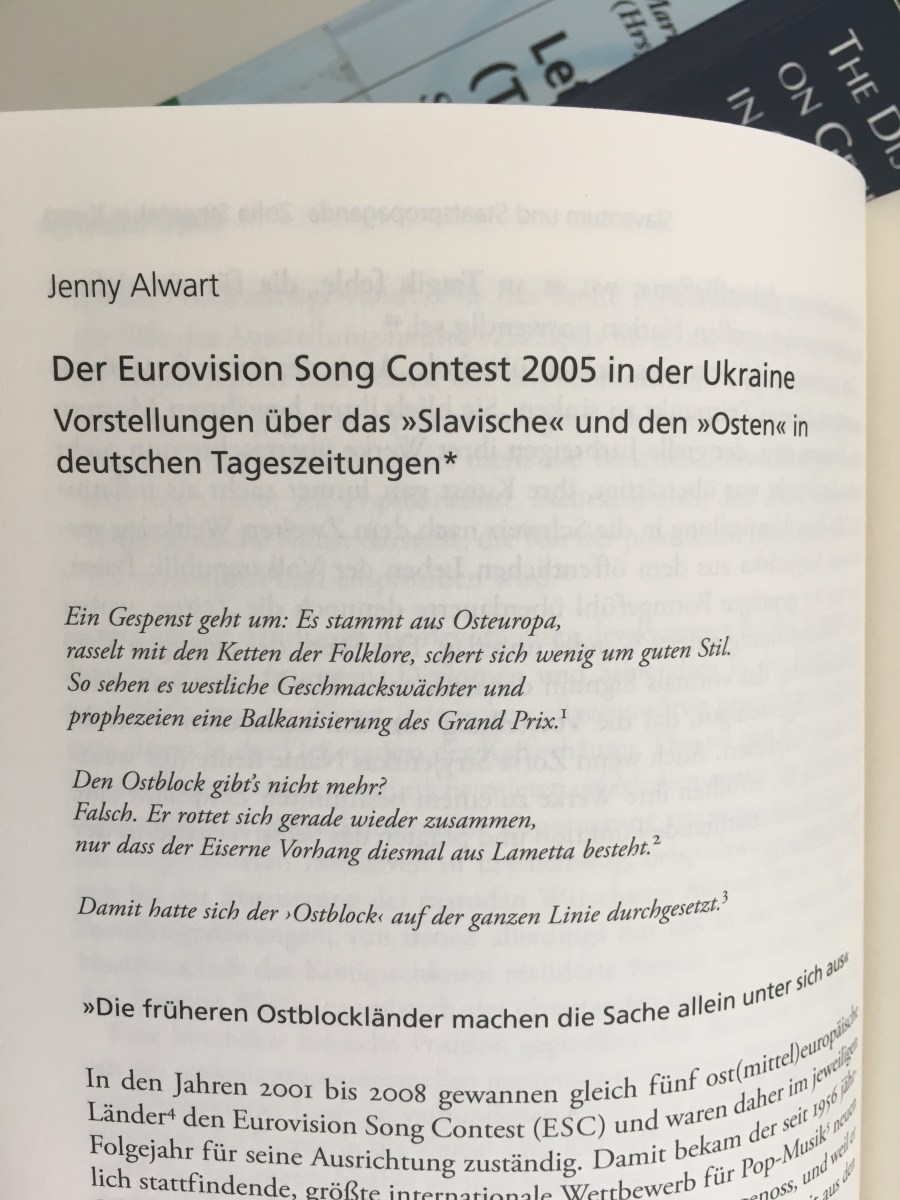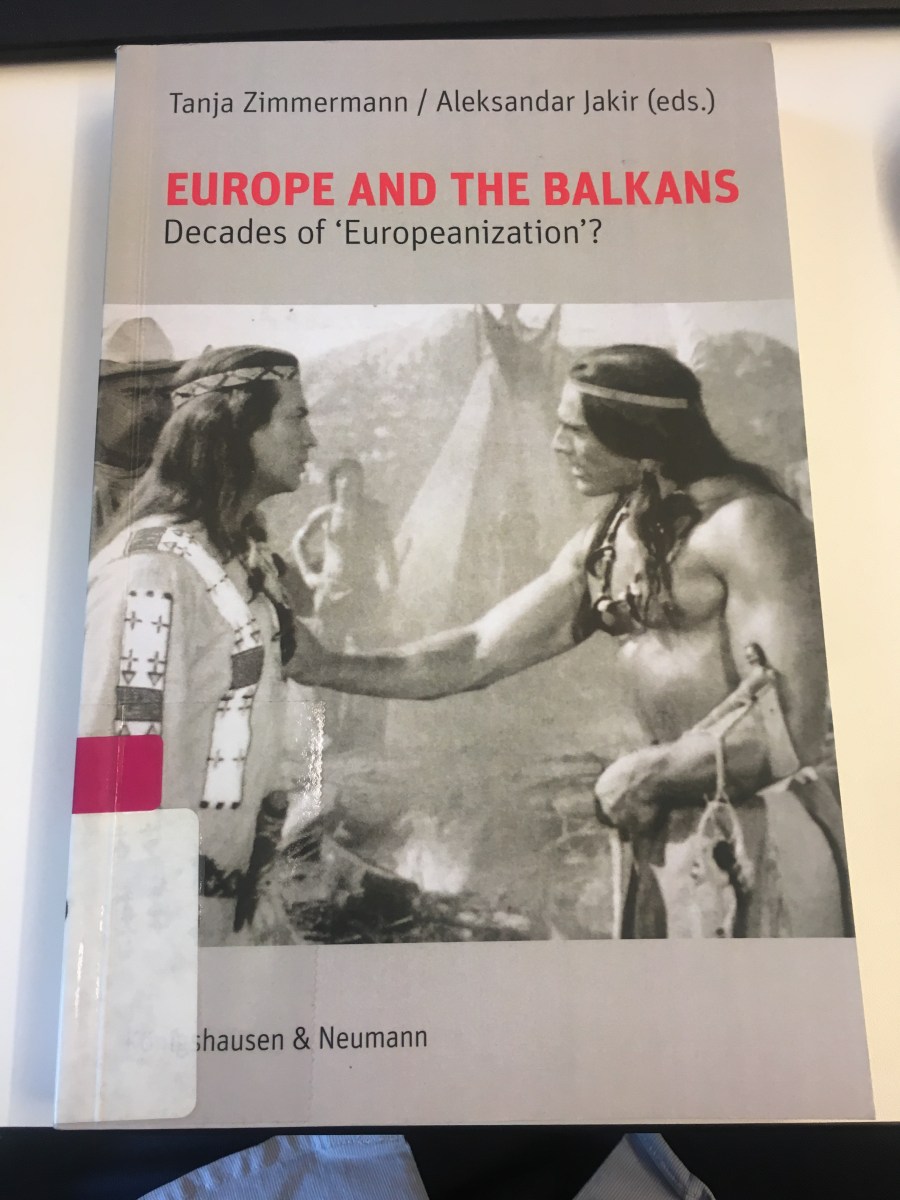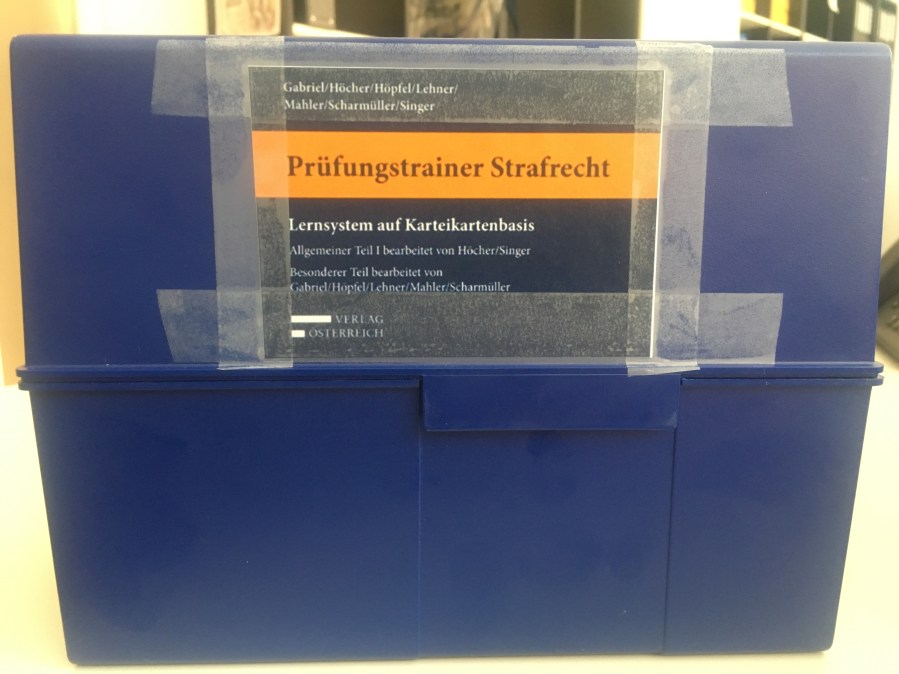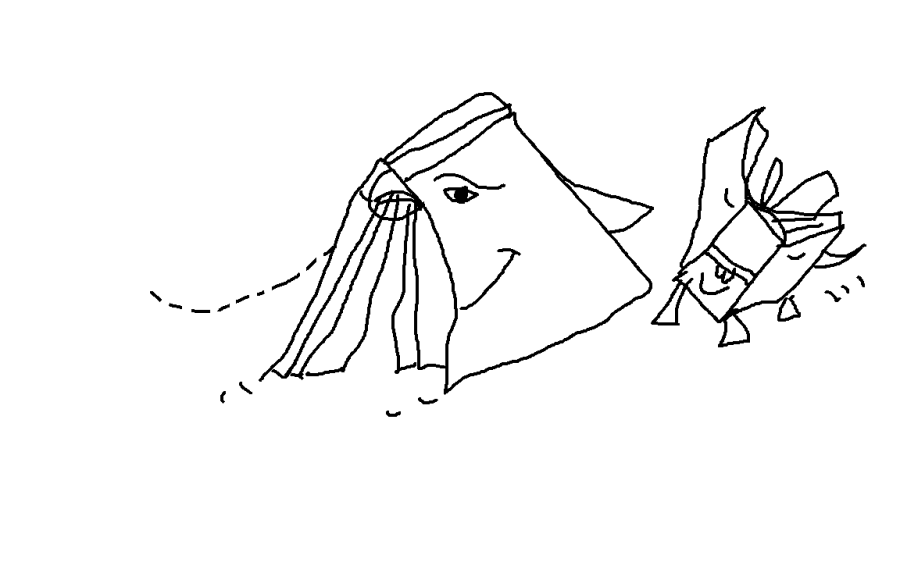Die Benutzer der Bibliothek treten auf den verschiedensten Kanälen mit uns in Verbindung, und sie bedienen sich dabei oft einer Sprache, die sich für Fachfremde nicht auf den ersten Blick erschließt. Wir verstehen so gut wie immer, was sie uns sagen wollen, auch wenn sie dafür in den seltensten Fällen die Begriffe verwenden, die die Bibliothek dafür gedacht hat. Wir sind Bibliothekare: Nichts Menschliches ist uns fremd! Und selbstverständlich läge es uns fern, uns über die Sprache oder die Ausdrucksweise unserer Benutzer lustig zu machen. Auch bedienen wir als Universitätsbibliothek ein internationales Publikum, nicht überall ist Deutsch die Arbeitssprache, und auch das schlägt sich in so mancher Konversation nieder. Manche Formulierungen geraten aber derart poetisch und bemerkenswert, dass sie im kollektiven Gedächtnis der Bibliothek haften bleiben, und dann erlauben wir uns bei aller Ernsthaftigkeit auch kurz darüber zu schmunzeln.
Fristenlauf: Dann bist du fällig!
Wenn Nutzer uns schreiben, geht es meistens darum, dass Bücher verlängert werden sollen, weil die Entlehnfrist „zugeschlagen hat“. Alleine wie viele Flexionsformen der Verben „entlehnen“, „vormerken“ und „ausborgen“ dadurch über die Jahre der deutschen Sprache hinzugefügt wurden, wäre genug Stoff, um ein Wörterbuch zu füllen.
Im Grunde ist es ganz einfach: Es gibt Bücher, und die kann man entlehnen. Dann befinden sie sich auf dem Benutzerkonto. Wenn man sie entlehnt, werden sie aus dem System AUSgebucht und auf das Nutzerkonto AUFgebucht, und bringt man sie zurück, passiert das Gegenteil. Läuft dann die Entlehnfrist für die Bücher ab, werden sie „fällig“, und hier beginnt der Stress des Nutzers und die Sprachverwirrung sich schon allmählich zu verdichten. Oder, um mit Shakespeare zu sprechen: Kein Borger sei / und auch ein Verleiher nicht.
Die Angst des Nutzers vor der Entlehnfrist
Glaubt man den Nutzern, wird bei uns mitunter fröhlich „ausgelehnt“ und „eingemerkt“, und das sind noch die harmlosesten Dinge, die man Büchern antun kann. Auch krassere Verschiebungen werden beobachtet, einmal hinsichtlich Grammatik („entborgt“, „vergebürgt“), andererseits hinsichtlich Bedeutung („belehnt“, „erlöst“). Das bringt uns in die Nähe von Bibel und Schuldrecht und macht klar, dass eigentlich alle immer ein bisschen Ritter und Burgen mit uns spielen wollen. Ein weiterer Kosmos im dramatischen Nutzervokabular (Schuld, Sühne, Strafe) eröffnet sich, sobald eine Frist versäumt wird und Gebühren angefallen sind. Hier wird von „Bußungsgebühr“ bis „Gnadenerlass“ alles aufgeboten, was das Herz der Bibliothekare erweichen soll; einmal schrieb gar einer vom Frieden, was wir als Angebot eines Waffenstillstands im Kampf Bibliothek gegen Nutzer natürlich begrüßen.
„Ich bin fällig! Bitte verlängern Sie mich!“, schrieb uns ein Nutzer vor Zeiten und erkannte die Dramatik seiner Situation damit recht gut. Bibliotheksausweise werden bisweilen nicht ausgestellt, sondern gelöst (wie beim Glücksspiel, „hallo, möchte lösen!“), was auf profunde Kenntnis altertümlicher Magistratsschalter verweist, wo man vor Aufruf tatsächlich ein Nümmerchen ziehen musste. Außerdem betont es den Lotteriecharakter der Sache, denn zumindest muss der verzweifelte Nutzer in der Regel warten, bis das glückliche Los ihn trifft und die Bibliothek die Bücher gnadenhalber noch einmal verlängert.
Zu großer Verwirrung führt auch das technische Vorhandensein des Nutzerkontos, auf dem die Bücher verzeichnet sind, und auch wenn Gegenteiliges angenommen wird („Hilfe, Ich bin in mein Konto gesperrt!“) nehmen wir keine Gefangenen.
Die Bücher, die es zu retournieren gilt, sind bisweilen „entlaufen“ (wie streunende Hunde), im schlimmsten Fall sogar „ausgelaufen“ (wie verschüttete Milch), und können nur durch maximale Dehnung der sprachlichen Grenzen wieder mühsam eingefangen werden.
 Die Bewohner des Meeres sind an den Mond gebunden
Die Bewohner des Meeres sind an den Mond gebunden
Diesen Satz schrieb mein Großvater in einem Schulaufsatz, und er meinte damit, dass Fische und andere Meerestiere der Gravitationskraft des Mondes unterliegen, was man gemeinhin als Ebbe und Flut kennt. Auf den ersten Blick erweckt der Satz aber ein anderes Bild, und er ist ein ideales Beispiel für die Poesie, die sprachlichen Formulierungen innewohnt, sobald sie unbeabsichtigt die strengen Grenzen der Sachlichkeit zu verlassen beginnen.
Aber auch unwissentlich kann man in der Bibliothek einen Haufen Unannehmlichkeiten anrichten. Schön, wenn dem zumindest eine gewisse Einsicht folgt.

Fremdwörter sind Glückssache
Enttäuschend bitter ist oft der kalte Wind der Expertokratie: Bücher und Medien älteren Jahrgangs werden bei uns in einem Magazin aufgestellt und das steht im Katalog dann auch so daneben: Magazin. Nicht wenige Nutzer vermuten, dass es sich dabei um einen Hinweis auf die Ausgabeform „Zeitschrift“ handelt, und assoziieren erfreut Titel wie Gala, Bunte, Die ganze Woche und ähnliche Friseurlektüre. Zeitschrift ist, was man liest, während einem die Haare geschnitten werden, also im besten Falle noch Profil und Spiegel.
Studierende, die noch nicht lange an der Uni sind, haben überhaupt mit dem Begriff „Zeitschriften“ noch einen unbefangeneren Umgang, weil sie erinnern, was dieser Begriff bisher in ihrem Leben geheißen hat. Sie wissen noch nicht, dass es sich dabei um jene sautrockenen, wissenschaftlichen Fachzeitschriften handelt, und der englische Begriff „Journal“ macht die Sache nicht besser („Da sind ja gar keine Bilder drin!“). Aus diesem Grund erlaube ich mir scherzhaft, in unseren Kursen gelegentlich die Unterscheidung in E-Zeitschriften und U-Zeitschriften (ernste Zeitschriften und Unterhaltungszeitschriften) zu treffen, die vielen aus der Musik bekannt ist.

Autocorrect: Manche Sätze ergeben einfach keinen Singapur
Nicht immer ist der eigene Wortschatz der auslösende Faktor. Auch wer sich textsicher durch die Bibliothekskanäle bewegt, scheitert gerne an der Bevormundung der Autocorrectur. Zutritt zur Universität erlangt zB unsereiner als Mitarbeiter mit einem Plastikchip, der vor ein Lesegerät gehalten wird. Für diesen elektronischen Schlüssel wird hier offiziell das Wort „Schließmedium“ gebraucht.
Als Bibliothekare brauchen wir das Wort sogar ziemlich oft, da es öfters technische Probleme mit den Zutrittssystemen der Bibliothek gibt. Die Autokorrektur des Outlook-Mail-Postfaches aber findet das Wort Schließmedium nicht besonders logisch, und macht daraus konsequent „Schließmuskel“ – zu welch fragwürdigen Briefwechseln dieser Umstand schon geführt hat, überlasse ich gerne Ihrer Fantasie.
Das Eindrücklichste sind sprachliche Fehlleistungen, die auch geübten Englischssprechern im puren Stress entstehen. So belehrte ich vor Jahren zwischen Tür und Angel einen Studenten selbstbewusst über unsere Öffnungszeiten am „Car Friday“, und wunderte mich über sein Unverständnis angesichts österreichischer Osterfeiertage.
Unvergessen bleibt auch jener Nutzer, der uns in einem ausnehmend freundlichen und etwas verschnörkelten Mail zum Abschluss „Viel Verderben!“ wünschte. Was immer genau er damit zum Ausdruck bringen wollte und in welcher Zeile des Wörterbuches er auch immer verrutscht sein mag, so wollen wir bei allem vorhandenen Sinn für das Abgründige doch zu seinen Gunsten annehmen, dass er nicht unseren Untergang wünschte.